Das Forschungsgeschäft und das Phänomen „Papierfabriken“

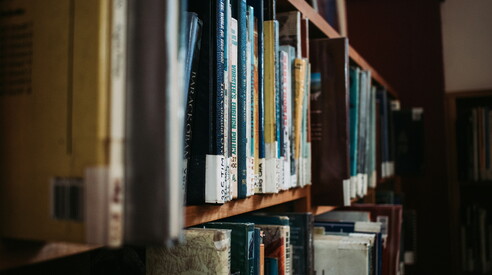
Foto von Muaawiyah Dadabhay auf Unsplash
Eine stille Krise
Die Wissenschaft unterliegt der Diktatur der Publikation, und es gibt diejenigen, die davon profitieren. Eine Untersuchung eines gescheiterten Modells.
Zum gleichen Thema:
Die Welt der Wissenschaft steckt in einer stillen Krise. Es handelt sich weder um einen Virus noch um einen Konflikt zwischen akademischen Theorien: Der Feind sind heute die Veröffentlichungen selbst. Die sogenannte „Papierfabrik“ – auf Italienisch „cartiere“ – bezeichnet ein beunruhigendes und immer stärker um sich greifendes Phänomen: die massenhafte Produktion und Veröffentlichung falscher, unbegründeter, ungeprüfter und kunstvoll konstruierter wissenschaftlicher Artikel mit dem alleinigen Ziel, Karrieren zu fördern, Fördermittel zu erhalten oder einfach akademische Lebensläufe aufzublähen . Eine Untersuchung der New York Times widmete sich kürzlich erneut dieser undurchsichtigen und verborgenen Welt. Doch das Problem ist alt, weit verbreitet und wird sich leider noch weiter verschärfen.
Die ersten systematischen Berichte über das Papierfabrik-Phänomen betrafen China, das von vielen Analysten als das eigentliche Epizentrum der Verbreitung dieser betrügerischen Mechanismen angesehen wird. Insbesondere wurde dokumentiert, wie einige chinesische Universitätskliniken und Forschungsinstitute jahrelang kostenpflichtige wissenschaftliche Schreibdienste nutzten, um ihren Ärzten und Forschern Veröffentlichungen in indexierten Zeitschriften zu sichern – oft eine wichtige Voraussetzung für den beruflichen Aufstieg oder eine Beförderung. Inzwischen hat sich dieses Modell zu einem regelrechten Parallelmarkt entwickelt, der maßgeschneiderte Artikel mit fiktiven Daten, manipulierten Bildern und kunstvoll konstruierten Zitaten produziert .

Das Phänomen wird durch die hohe Zahl von Selbstzitaten im chinesischen Wissenschaftssystem noch komplexer: Analysen zufolge stammen über 60 Prozent der Zitate zu in China veröffentlichten Arbeiten von chinesischen Forschern selbst. Diese Zahl trägt dazu bei, Chinas tatsächlichen wissenschaftlichen Einfluss zu verzerren und deutet auf strukturierte Praktiken wie das „Stacking“ von Zitaten oder gegenseitige Zitate hin, die den wissenschaftlichen Einfluss aufblähen sollen . China hat hier eine Vorreiterrolle übernommen und ein Modell exportiert, das nun – mit Variationen – in anderen Ländern nachgeahmt wird.
Nach China und den USA liegt Italien beim „Citation Stacking“ weltweit an dritter Stelle. Eine in Plos One veröffentlichte wissenschaftliche Studie analysierte diese Praxis unter italienischen Forschern. Dabei ist zu beachten, dass die italienischen Zahlen deutlich niedriger sind als die chinesischen. Betrachtet man jedoch den aktuellen Stand der Forschung in Italien – einem Land mit wenigen Absolventen, wenigen Forschern und geringer Finanzierung für den Sektor – ist die hohe Zahl an Veröffentlichungen, die Italien an die Spitze der Weltrangliste katapultiert hat, bemerkenswert. Diese Zahlen können jedoch einige Bedenken aufwerfen. Antonio Cassone , Mikrobiologe und ehemaliger Direktor der Abteilung für Infektionskrankheiten am Istituto Superiore di Sanità, bestätigte diese Zweifel gegenüber Il Foglio: „Italienische Forscher sind sicherlich sehr produktiv, aber die Tatsache, dass unser Land in den letzten Jahren in der Weltrangliste so weit nach oben geklettert ist, könnte Zweifel an der wissenschaftlichen Validität einiger ihrer Arbeiten aufkommen lassen.“ Cassone, Autor eines kürzlich erschienenen Essays zu diesem Thema, fügt hinzu: „Wir sprechen hier nicht mehr von gelegentlichen Fehlern oder minderwertiger Forschung. Wir haben es mit einem Parallelsystem zu tun, einem organisierten Markt, der die Notwendigkeit ausnutzt, zu veröffentlichen, um die eigene Karriere voranzutreiben.“
Laut Cassone ist die treibende Kraft hinter diesem Phänomen der unhaltbare Druck, dem die Forscher ausgesetzt sind. In der Wissenschaft ist das Publizieren eine Notwendigkeit, unabhängig vom Inhalt – das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass der Name des Autors schwarz auf weiß in einer Zeitschrift erscheint, vorzugsweise einer internationalen. Cassone nennt eine vielsagende Zahl, die das enorme Ausmaß des Phänomens verdeutlicht: Im letzten Jahr wurden weltweit etwa 2,5 Millionen wissenschaftliche Artikel veröffentlicht . Diese Zahl wirft eine entscheidende Frage auf: Wie viel dieser Produktion stellt echte Wissenschaft dar, die überprüfbar, präzise und für den Fortschritt nützlich ist? Diese Frage können wir nicht länger ignorieren, da der Anteil minderwertiger oder völlig fiktiver Werke exponentiell wächst.
Auch Giuseppe Novelli, Genetiker und ehemaliger Rektor der Universität Tor Vergata in Rom, prangert das Phänomen an: „Es geht hier nicht nur um schlecht geschriebene Artikel. Der springende Punkt ist, dass viele dieser Studien mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt oder stark manipuliert werden.“ Novelli erklärt gegenüber Il Foglio, dass KI zwar leistungsstarke Werkzeuge für die Forschung bietet, aber auch Risiken birgt, wenn sie ohne ausreichende kritische Prüfung eingesetzt wird. KI kann zur Verbreitung von Fehlinformationen beitragen, sinnlose Sätze konstruieren und falsche oder unangemessene Zitate generieren. Ein häufiges Beispiel: Beim Lesen von Sätzen, in denen Artikel als „kürzlich veröffentlicht“ zitiert werden, stellt man fest, dass die betreffenden Studien sechs oder sogar sieben Jahre alt sind. Für Novelli „ist dies ein typischer Fehler künstlicher Intelligenz: Ihr fehlt kritisches Denken, sie versteht den zeitlichen Kontext nicht und hat in vielen Fällen nur Zugriff auf die Abstracts bestimmter Forschungsstudien, die oft nur über ein kostenpflichtiges Abonnement zugänglich sind.“
Doch das Problem endet nicht mit dem unsachgemäßen Einsatz von KI. Novelli weist auch auf den Qualitätsverlust des Peer-Review-Verfahrens hin, das die Zuverlässigkeit wissenschaftlicher Artikel gewährleisten soll. Zu viele Zeitschriften, zu viele zu bewertende Artikel und zu wenige kompetente Gutachter, die bereit sind, sich die nötige Zeit zu nehmen. Die Folge ist, dass inkonsistente und sogar betrügerische Studien die redaktionelle Prüfung bestehen und mithilfe dieses Geschäftsmodells in Zeitschriften veröffentlicht werden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Veröffentlichung eines Artikels zwischen 3.000 und 4.000 Euro kostet, während einige „Publishing-Services“, die eine schlüsselfertige Veröffentlichung versprechen, Komplettpakete anbieten, die bis zu 30.000 Euro kosten können . Ein Multimillionen-Dollar-Markt, der nicht auf wissenschaftliche Genauigkeit, sondern auf Profit abzielt.
Dieser Anstieg verdächtiger Veröffentlichungen wird durch ein zutiefst fehlerhaftes Anreizsystem vorangetrieben. Auch Giuseppe Traversa, Epidemiologe und ehemaliger Forscher am Istituto Superiore di Sanità, unterstützt diese Behauptung. Traversa erklärt gegenüber Il Foglio, dass in der Forschung heute die Leistung in erster Linie anhand der Zahl der veröffentlichten Artikel und der erhaltenen Zitierungen beurteilt wird. Dieses System belohnt eindeutig Quantität, nicht Qualität. Wenn 100 Veröffentlichungen – selbst bescheidene – ausreichen, um einen Wettbewerb zu gewinnen oder sich Fördermittel zu sichern, wird die Versuchung groß, das eigene Profil aufzublähen . Die Folgen sind verheerend und vielfältig. Erstens besteht die Gefahr, dass die – ohnehin schon knappen – öffentlichen Mittel für Projekte mit geringem Wert abgezweigt werden und diejenigen, die wirklich hochwertige Forschung betreiben, benachteiligt werden. Der schwerwiegendste Schaden jedoch ist der Vertrauensverlust. Wenn selbst Außenstehende den Verdacht hegen, dass hinter bestimmten Veröffentlichungen ein Vakuum – oder schlimmer noch, vorsätzlicher Betrug – steckt, gerät das gesamte System ins Wanken. Wir haben dies während der Pandemie deutlich gesehen, als Fake News und ungeprüfte Studien dazu beitrugen, Verwirrung und Misstrauen zu säen.
Um die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, sei laut Cassone eine Kulturrevolution nötig: Wir müssten wieder die Qualität der Forschung belohnen, nicht die Quantität der Veröffentlichungen. Wir könnten einen Forscher nicht mehr allein anhand der Zeitschrift beurteilen, in der er publiziert; wir müssten seine Texte lesen, den Inhalt verstehen und seinen tatsächlichen Beitrag bewerten. Novelli fordert zudem strengere Kontrollen: Erforderlich seien eine wirksame redaktionelle Vorprüfung sowie eine stärkere multidisziplinäre Begutachtung. Traversa betont schließlich die dringende Notwendigkeit einer Reform des Anreizsystems: Wir müssten den tatsächlichen Wert der Forschung bewerten, nicht die abstrakte Anzahl der Veröffentlichungen. Die drei Experten sind sich einig, dass das italienische System derzeit weniger anfällig ist als in anderen Ländern, wo akademische Karrieren eng mit der redaktionellen Leistung verknüpft sind. Das heißt aber nicht, dass wir immun sind. Grobe Fehler, Oberflächlichkeit, Falschdarstellungen und subtile Manipulationen sind in der italienischen Wissenschaftslandschaft bereits präsent . Und die Leichtigkeit, mit der es heute möglich ist, publikationsfertige Studien zu erwerben, sollte Institutionen und der akademischen Gemeinschaft eine Warnung sein.
Wissenschaft ist naturgemäß ein selbstkorrigierender Prozess, und mit der Zeit kommt immer wieder Betrug ans Licht. Deshalb muss die Kontrolle präventiv und nicht nur nachträglich erfolgen: In jeder Phase des Veröffentlichungsprozesses sind mehr Wachsamkeit, mehr Genauigkeit und Transparenz erforderlich. Letztendlich, so Cassone, „begann diese Geschichte mit einem kleinen Sandkorn“. Doch wenn wir nicht die nötige Aufmerksamkeit schenken, droht dieses Sandkorn zu einer Lawine zu werden, die alles überwältigen kann, selbst den Glauben, den wir jahrhundertelang in die Macht der Vernunft gesetzt haben.
Mehr zu diesen Themen:
ilmanifesto




